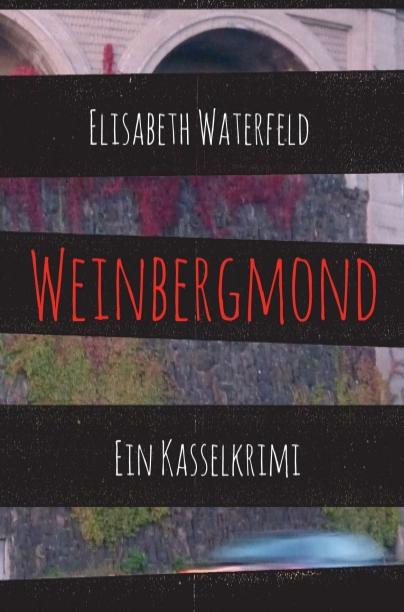Den Inhalt des Gespräches hatte Diana als sehr unangenehm empfunden. Die Anwesenheit dieses leicht zerstreut wirkenden Kommissars mit seinem ebenso zauseligen Dackel und dem unverkennbar österreichischen Akzent hielt sie jedoch für sehr sympathisch und ihr fiel auf, wie gut ihr deren Dasein im letzten Moment noch getan hatte.
Jetzt, als beide gegangen waren, schien ihr die Nachricht den Boden unter den Füßen zu nehmen. Nicht nur, dass ihre nette Praktikantin das Opfer des „Medusenmörders“ geworden war, sondern es war vor allem das Bild des zweiten Opfers, über das sie nachdachte. Sie war sich sicher, ihn zu kennen.
„Tut Dir auch mal gut, wenn einer Dein Revier angreift und Du Dich etwas bewegst.“
Moustache kniff leicht die Augen zusammen, kümmerte sich aber nicht mehr weiter um den Kommentar, hatte er sich doch nach einer ersten Inventarisierung des Gegners schnell wieder auf seine faule Haut zurückbegeben.
Diana versuchte, Mina anzurufen, warf das Telefon aber nach einem enttäuschten Warten des Freizeichens zurück auf die Ladestation.
„Naja, dann gibt´s heute mal Döner.“ Jetzt nach Feierabend kam sich Diana irgendwie verraten vor. Hatten vor ihr schon alle Kollegen Bescheid gewusst und hatte man sie mit den Fotos allein zurück gelassen? Gehörte sie doch noch nicht so dazu, wie man es sie spüren ließ? Vor ihrem geistigen Auge sah sie alle Mitglieder der Bereichsbibliotheken an einem riesigen runden Tisch mit nachdenklichen Gesichtern über dem Fall brütend, während sie selbst seelenruhig Bücherstapel zurück ins Regal sortierte.
Sie wollte Mina zur Rede stellen. Jetzt, wo die Einsamkeit sich immer weiter in Angst umkehrte, wählte sie eine für sie eher unkonventionelle Methode und begab sich auf direktem Weg entlang der Frankfurter Straße zu Handren, der in vollem Gange duftendes Fladenbrot mit allerlei Fleisch und Gemüse belegte.
„Ah, hallo Diana, warte, ich komme gleich. Heute ist viel los, mein Neffe hilft mit.“
„Ja, danke.“ Sie wählte einen Tisch in der hinteren Ecke des Lokals. Er schien ihr in dieser Situation die richtige Wahl zu sein. Gerade groß genug für zwei Personen und eher dunkel sehr nah an der Wand gelegen. Diana lächelte, als sie die kitschige, aber liebevolle Herbstdekoration sah, die die Familie auf den Tischen arrangiert hatte.
„Na, gefällt Dir die Deko?“
„Ja und so schön passend zum Wetter. Kann ich eine Salattasche bekommen?“
„Klar, Semir, mach´ unserer besten Kundin einen schönen großen vegetarischen Döner mit extra scharfer Sauce.“
„Danke.“ Sie lächelte leicht, wusste er doch immer, welche Zutaten sie bevorzugte.
„Schön, dass Du kommst. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht´s Dir?“
„Du, diese Medusa, von der in der Zeitung die Rede war, das war unsere Praktikantin.“
„Wirklich? Erzähl!“
Sie begann zu erzählen vom absurden Besuch des österreichischen Kommissars und von der Praktikantin, die ihr Praktikum schon vor etwa dreieinhalb Jahren in der Bibliothek beendet hatte. Seit dieser Zeit hatte Diana gedacht, dass die junge Frau zurück nach Gdansk gegangen war. Kommissar Gardner hatte ihr jedoch mitgeteilt, dass sie eine Stelle an der Uni Kassel angenommen hatte.
„Siehst Du? Man registriert manche Menschen kaum. Dieses hübsche Mädchen – und ich weiß nichts mehr von ihr. Noch nicht mal auf dem Bild habe ich sie richtig erkannt.“
„Ach, da mach´ Dir mal keinen Vorwurf. Menschen sehen sich eben oft ähnlich.“
„Die hatte hier wahrscheinlich niemanden. Der Kommissar sagt, die Überführung nach Polen würde problematisch. Sie soll zu Hause bei ihren Eltern begraben werden.“
„Verstehe.“
„Er hat mir zwei Fotos gezeigt. Auf dem einen war sie abgebildet und Handren?“
„Mhm?“
Sie beugte sich jetzt näher zu ihm über den Tisch, dabei fühlte sie, wie das Feuer der Kerze warm auf ihre Arme schien.
„Auf dem zweiten Foto war eine neue Leiche. Du musst dichthalten. Ich weiß nicht, ob das schon öffentlich werden darf, aber ich glaube, den kenne ich.“
„Wen?“
„Ein Mann Mitte Dreißig wurde bei der Teufelsbrücke im Bergpark gefunden.“ Sie nahm einen großen Bissen und spürte, wie sie wieder zu Kräften kam.
„Ja, und? Weiter!“
„Sein Gesicht war total blutig und zerkratzt, er lag irgendwie unnatürlich, außerdem hatte er einen Speer in der Hand.“
„Einen Speer?“ Handren sprach das Wort aus, als hätte er etwas fremdes im Mund, dessen Geschmack ihm noch unbekannt war. Diana machte eine ausladende Bewegung mit ihrem Arm, bei dem sie eine Faust ballte. „Ja? Speer zum Werfen.“ Handren hielt inne, Diana kaute weiter.
„Zum Töten.“ kam ihr leiser über die Lippen und Handren verstand.
„Und Du denkst, Du kennst ihn?“
„Ja, von früher, aber ich weiß nicht woher, das Gesicht ist ja nicht mehr zu erkennen und wegen der Irena kamen sie dann auf mich. Sie gehen von einem Serienmord aus, weil beide eben nicht einfach so umgebracht wurden.“
„Mhm, hast Du mal im Handy nachgesehen?“
„Im Handy?“
„Na Kontakte! Da guck´ ich manchmal, wenn mir der Name nicht einfällt.“ Etwas genervt zog Diana ihr Handy aus der Tasche bar jeglicher Hoffnung, dass das etwas bringen könnte. Sie hatte viele Kontakte gespeichert, von denen sie nur etwa eine Handvoll brauchte. Eigentlich hätte sie den Speicherplatz auch freihalten können, aber etwas stolz war sie immer auf die stattliche Telefonliste gewesen, die sie seit der Existenz ihres ersten Handys ständig erweitert hatte.
„Anne, Beyer, Decker, Mina, Pizzablitz, Schneider, Schrödter, Zilinsky, was soll das bringen?“ Unzählige Vor- und Nachnamen in alphabetischer Reihenfolge rauschten blitzschnell vorbei und Handren schnalzte anerkennend mit der Zunge.
„Wen Du alles kennst! Bist ja ganz schön wichtig, Prinzessin.“ Er lachte herzhaft.
„Deinen Speicher will ich mal sehen! Die ständigen Nachrichten, die Du von Deiner ganzen Familie bekommst.“
„Da hast Du Recht, aber Bürgermeister stehen bei mir nicht drin.“
„Ach, Du spinnst.“ Der Abend war für Diana beruhigend und sie war mit Handren über die Fälle auf ungezwungene Art ins Gespräch gekommen.
Übersatt von den Spezialitäten, die sie allesamt probieren musste, steuerte sie den Heimweg an und bewunderte die Beleuchtung der wenigen Schaufenster, die sehr sorgfältig eine Auswahl ihres Warenangebotes präsentierten. Sie hörte wieder ihre Schuhe auf dem Asphalt und blickte hoch. Eisenwaren Heinrich Koch, das kleine Reisebüro, Haarstyling Schrödter oder ein paar Kunstgalerien waren die noch heimlich Herrschenden der Südstadt, die den neuen 99-Cent-Läden die Stirn bieten wollten. Schrödter?!